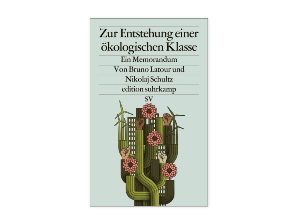«Wie schaffen wir eine machtvolle Gegenkultur?»
Luisa Neubauer und Nikolaj Schultz bei der «Langen Nacht des Klimas» 2023 in Berlin
Die Fakten zur Klimakrise sind klar. Doch wir als Gesellschaft müssen ins Handeln kommen. Ein abendlicher Austausch in der «Kulturfabrik Moabit».
Volle Reihen im Theatersaal, gespannte Gesichter: Zum Abschluss der Langen Nacht des Klimas am 2. September 2023 trafen sich zwei Menschen zum Diskurs, die recht unterschiedlichen Sphären entstammen – Luisa Neubauer, Geografiestudentin und das Gesicht von «Fridays for Future» in Deutschland, und der dänische Soziologe Nikolaj Schultz, der 2022 gemeinsam mit Bruno Latour das viel beachtete Buch «Zur Entstehung einer ökologischen Klasse: Ein Memorandum» veröffentlichte.
Was die beiden eint – das konnte man an diesem Abend erleben –, ist ihre gemeinsame Sicht auf die Hemmnisse der Klimakommunikation. Die Botschaften der Klimabewegung seien alarmierend, träfen aber, wohl auch deswegen, auf vielerlei Abwehr: auf persönliche Verdrängungsmechanismen, Hass und Häme, Schutzfluchten in die Wunschwelten der Konzerne und in Verdrehtheiten neoliberaler Scheinweltjongleure. Selbst Katastrophen wie die Ahrtal-Flut, so Neubauer illusionslos, sprächen wohl nicht mehr ohne Weiteres für sich selbst. Derlei Mechanismen gilt es etwas entgegenzusetzen – nämlich positive und verbindende Gegenbilder zu den apokalyptisch anmutenden Klimaszenarien, die uns ins Haus stehen: ein «Narrativ, das die Leute mitnimmt», wie Neubauer es 2019 auf einem Grünen-Parteitag genannt hatte. Drei Jahre später wurde sie vor demselben Plenum deutlicher: «Wir kämpfen hier nicht, weil es leicht ist. Sondern weil wir wissen, dass auf dem Spektrum von viel Katastrophe und unerträglicher Katastrophe so unfassbar viel zu verlieren und – viel mehr noch – unendlich viel zu gewinnen ist.»
Doch was genau? Und womit wäre es zu gewinnen? Schultz hält es «für eine Frage der Worte, der Begriffe. Warum nennen wir es ‹Degrowth›, warum nicht Wohlstand? ‹Wirtschaftswachstum› ist schrecklich. Denn Wachstum schmälert mittlerweile die Möglichkeit des Wohlstands, nimmt die Luft zum Atmen.» Und er ermutigt, die Arbeit an der «Begriffswelt» fortzusetzen. Auf kultureller Ebene Mehrheiten zu vereinen und auf verbindende Ziele einzuschwören, das klingt in diesem Zwiegespräch immer wieder an: als lohnenswerte Aufgabe, als möglicher Weg, den auch Schultz und Latour in ihrem Buch aufzeigen – dort jedoch auf nichts Geringeres als die Formierung einer «ökologischen Klasse» ausgerichtet. Erfahren Sie im Folgenden, wie Schultz diesen Gedanken auf der Langen Nacht des Klimas weiter ausgeführt hat – und welchen Widerhall er im anschließenden Vortrag von Luisa Neubauer erfuhr.
Nikolaj Schultz Zur «ökologischen Klasse»

Die Lange Nacht des Klimas war bereits weit fortgeschritten, als Nikolaj Schultz die Bühne betrat. Der dänische Soziologe führte das Publikum in die Kernpunkte seines mit Bruno Latour verfassten Memorandums ein – und forderte dazu auf, den ökologischen Kampf auch und gerade auf kulturellem Gebiet zu führen.
Zum Gedenken an Bruno Latour und seinen Beitrag zur politischen Ökologie möchte ich eine Einführung in unser gemeinsames Buch und seine Entstehung geben. Bruno war ein beeindruckender Intellektueller – und ein herzlicher, großzügiger, sehr lustiger Mensch. Einmal rief er mich nach dem Erscheinen unseres Buches an und bestellte mich in ein Restaurant; es ginge um sehr Wichtiges. Ich wusste schon, dass er krank war, und machte mir Sorgen. Ich komme also an seinen Tisch, setze mich. Er schaut mich ernst an, meint dann: «Ich muss dir was sagen.» Ich dachte: «Okay?» Er sagte: «Mir wurde etwas klar: Wir haben recht – und die anderen nicht!» Dann konnten wir zu Mittag essen.
Bruno hätte es sicher sehr gefreut, dass unsere Argumente nun auch in kulturellen Institutionen, in Häusern wie diesem, kursieren. Denn solche Orte fand er enorm wichtig für den Aufbau einer neuen, gemeinschaftlichen Welt. Bruno war ein wunderbarer Mensch; die Arbeit mit ihm hat mich glücklich und stolz gemacht. Damit nun zu den drei Kernpunkten unserer Denkschrift.
Ökologie – überall und nirgendwo
Ein paar Worte zum Kontext vorweg: Bruno und ich schrieben das Buch im Sommer 2021 – vor den französischen Wahlen. Uns trieb damals um, dass Ökologie in Frankreich überall und nirgends war. Zum einen ist sie allgegenwärtig: Jeden Tag erreichen uns katastrophale Nachrichten, Warnzeichen des von uns beeinflussten Erdsystems. Zumindest in Europa ist die ökologische Frage längst das politische Hauptthema – Ökologie ist überall. Zum anderen ist sie nirgends: So kämpfen die grünen Parteien in vielen Ländern, mit wenigen Ausnahmen wie Deutschland, darum, auch nur in die Parlamente einzuziehen.
Wir fragten uns also: Woher kommt diese Fehlausrichtung, die Asymmetrie der Wirkungen? Warum nehmen wir die Katastrophensignale nicht wahr? Weshalb ergeben sich aus ihnen kaum politische Effekte, erwächst daraus praktisch keine Mobilisierung? Aus der Analyse dieser Stagnation heraus zeigen wir dann auf, wie wir womöglich zu einer neuen Ökologiebewegung, einer soliden politischen Ökologie gelangen und einer solchen Ideologie zu Stärke und Beständigkeit verhelfen können – damit sie endlich auf Augenhöhe mit den alten, noch immer bestimmenden Ideologien konkurriert. Nun zum ersten Kernpunkt.
Die Natur vereint uns nicht – sie trennt uns
Jedes Jahr erleben wir, wie die Klimakatastrophe an Ausmaß und Intensität zunimmt. Warum also handeln wir nicht? Wahrscheinlich wissen wir schlicht nicht, wer dieses «Wir» eigentlich ist. Viel zu lange ist die politische Ökologie über sich selbst gestolpert. Es gelang ihr nicht, ihr Projekt als etwas Universelles zu formulieren und so darzustellen, dass es uns vereinen könnte. Und sie erwartete lange, dass wir schon alle zusammenkommen würden, wenn die Katastrophe nur nahe genug rückte – als könne die Ökologie wie von selbst soziale Konflikte beilegen und uns auf ein gemeinsames politisches Projekt einschwören.
Sorry, aber die Ökologie ist kein «Friedensvertrag»! Wir sehen es überall: Von «Fridays-for-Future» über «Extinction Rebellion» bis hin zu den Kämpfen der indischen Bauern – bei politisch-ökologischen Fragen ist die Lektion immer dieselbe: Die Natur vereint uns nicht – sie trennt uns. Doch das ist nicht die Achillesferse der Ökologie. Denn die Sozialgeschichte lehrt uns, dass Konflikte weitaus mehr politische Wirkung entfalten und mobilisieren als Friedensprojekte. Frieden und Harmonie bringen Menschen zum Gähnen – Konflikte machen sie dagegen kampfbereit.
Das Problem ist also nicht der Konflikt als solcher, sondern dass es der politischen Ökologie nicht gelungen ist, die neuen Konflikte längs der Klima- oder Biodiversitätsfrage zu identifizieren und sie zu einer einheitlichen und wirklich mobilisierenden Erzählung zu verbinden – um damit zunächst ein «Wir» und ein «Sie» zu definieren. Das ist unser erster Punkt: Damit die politische Ökologie eine starke ideologische Wirkung entfalten kann, muss sie ihr politisches Projekt längs der Konfliktlinien vertreten und vermitteln. Die Frage lautet: Mit welcher Erzählung?
Ein neuer Klassenkampf
Hier komme ich zum zweiten Punkt: Historisch gesehen war ein Konzept besonders hilfreich, um soziale Konflikte abzugrenzen und zu beschreiben, um Relevanz herzustellen und zu politischem Handeln anzuregen: das der Klassen. Dabei war diese Erzählung nie in Stein gemeißelt, sondern verknüpfte im Lauf der Zeit verschiedenste Bedeutungen – ein umstrittenes Konzept, dem die Sozialwissenschaft kontinuierlich neue Aspekte und Nuancen hinzufügte. Die Geschichte des Klassenbegriffs kann also auch als eine Geschichte des Verrats an der eigentlichen Idee verstanden werden; schließlich haben sich die Gesellschaft, ihre materielle und kulturelle Infrastruktur und ihre Ungerechtigkeiten verändert, wodurch sich die sozialen Kämpfe stark diversifizierten. Umgekehrt kann die Klassenerzählung aber auch als eine Geschichte konzeptioneller Loyalität verstanden werden.
Warum? Nun, wer immer versucht hat, das Narrativ der Klasse anzupassen oder zu nuancieren, musste in Dialog mit der Klassenerzählung von Karl Marx treten – oder sie kritisieren. Es gab im 20. Jahrhundert wohl kaum ein wirkungsvolleres Narrativ als dieses, das der Soziologie einen theoretischen Rahmen und zugleich der allgemeinen politischen Kultur Auftrieb verlieh. Marx lieferte uns so etwas wie einen präzisen Kompass, der uns zu verstehen half, welchen Entwicklungsprozessen Gesellschaften ausgesetzt sind, in welche Konflikte sich die Menschen verwickeln und in welche Richtung die Geschichte fortschreiten würde.
Dabei war Marx’ Vorstellung von Klasse immer an das Ideal einer sozialen Transformation gebunden – es war nie nur ein beschreibendes, sondern stets ein normatives Konzept. Denn entlang der sozialen Konfliktlinien und darauf aufbauend bot es Perspektiven für politisches Handeln. Marx wollte ergründen, wie sich Gesellschaften sozial und materiell reproduzieren – und wo die Menschen in diesem Prozess positioniert sind. Wer sind ihre Verbündeten, wer ihre Gegnerinnen und Gegner? In welche Widersprüche sind sie verstrickt? Und noch einmal: Wie geht die Geschichte weiter?
Wenn Frontlinien sich verschieben
Die Klassenerzählung ist historisch deshalb so bedeutsam, weil Marx mit ihr verständlich machen konnte, wie sich die Kämpfe, sozialgeschichtlich betrachtet, sozusagen rund um die Produktionsmittel organisierten. Er beschrieb, wie die Produktion den Fortbestand der Gesellschaft erst ermöglichte und wie die Klassen – Menschen mit unterschiedlichen Positionen im Produktionssystem – dann im Kampf um die Produktionsmittel aufeinanderprallten, bei dem es schließlich zu einem revolutionären Eigentumswechsel zwischen Proletariat und kapitalistischer Klasse kam. Die Aufmerksamkeit von Marx, und damit der Kompass der Klassentheorie, ist wohl klar auf die Produktivkräfte ausgerichtet.
Doch genügt dieses Denken in Produktionsbegriffen heute noch, um herauszufinden, wie Gesellschaften weiter bestehen oder Klasseninteressen sich verändern können? In unserem «neuen Klimaregime», wie Bruno es nannte, also in einer Ära, die von Katastrophen und Krisen geprägt ist, sehen wir gerade, wie rasch sich die materielle Infrastruktur der Gesellschaft verändert.
Geschichte ist eine merkwürdige Sache, die manchmal tanzt. Und heute hat sie eine sehr seltsame Wendung genommen: Denn der Fortbestand unserer Gesellschaften wird nicht mehr allein durch die Produktion gesichert, sondern auch durch den Erhalt der Ökosysteme, die unsere Erde bewohnbar machen. Noch verdrehter erscheint, dass es gerade unsere Produktionsweise ist, die nachweislich den Wohlstand und damit unsere Lebensbedingungen destabilisiert. Das Überleben der Gesellschaften kann damit nicht länger eine Sache der Produktion sein.
Mittlerweile könnte man sogar sagen, dass unsere Gesellschaften beginnen, trotz der Produktionsverfahren zu überleben, deren Systeme zu einer täglich größeren Bedrohung für unsere Existenz werden. In den Worten von Marx: «Alles, was fest ist, schmilzt in der Luft.» Wir begreifen so langsam, dass die Gesellschaft einer weiteren materiellen Grundlage neben der Produktion bedarf – nämlich intakter Erdsysteme.
Doch diese materielle Transformation verändert die Form des Klassenkampfs: Es geht nicht länger um die Übernahme der Produktionsmittel oder um eine gerechtere Verteilung der Erträge. Der ökologische Klassenkampf dreht sich vielmehr um die Vorhersehbarkeit, die Sicherung und die Aufrechterhaltung unserer Lebensbedingungen. Dadurch entsteht eine klare Frontlinie zwischen solchen, die destruktive Produktionspraktiken begrenzen wollen, und all jenen, die sie wie gewohnt weiter ausbauen möchten. Genau hier sehen wir das Potenzial für ein kollektiv verbindendes, politisch-ökologisches Narrativ, die Möglichkeit zum «Wir». Und eine Chance, die Richtung der Geschichte zu verändern: In den Ruinen der Produktion zeichnen sich die ersten Konturen einer «ökologischen Klasse» ab.
Der unerlässliche Kulturkampf um Ideen
Ein kurzes Zwischenfazit, bevor ich zum dritten und letzten Punkt komme: Die politische Ökologie, die Klimabewegungen, die grünen Parteien müssen zunächst akzeptieren, dass die Ökologie kein Friedensvertrag ist, sondern ein Schlachtruf. Darauf aufbauend gilt es, das «Wir» und ein «Sie» zu klären, müssen Menschen, die gegen unsere Produktionsweise kämpfen, zu einer fest umrissenen Klasse vereint werden.
Dabei täten die ökologisch Gesinnten gut daran, anzuerkennen, dass «objektive Klasseninteressen» nie genügt haben, um eine politische Ethik zu schaffen, eine politische Mobilisierung herbeizuführen – oder gar ein starkes Klassenbewusstsein zu erzeugen. Im Gegenteil: Die Sozialgeschichte zeigt, dass es eines ganzen kulturellen Arsenals an Konzepten, Bildern, Visionen und Narrativen bedarf, um politische Effekte zu erzielen. Anders ausgedrückt: Lange bevor man sich erhoffen kann, politische Macht zu erringen, gilt es, kulturelle Macht zu erobern.
Und doch haben gerade grüne Parteien in dieser Hinsicht kaum etwas vorzuweisen. Die sozialistischen, liberalen und illiberalen Ideologien mögen veraltet und den kommenden Katastrophen nicht gewachsen sein, aber sie haben ein breites Spektrum an Ideen, Konzepten, Werten und Bildern parat, um ihre Projekte erstrebenswert erscheinen zu lassen.
Die grünen Parteien hingegen scheinen dem Irrglauben verfallen, dass die Katastrophe selbst ausreichen würde, um eine politische Wirkung zu erzeugen – oder wann haben Sie zuletzt eine für die Grünen kandidierende Person im Fernsehen gesehen, die in der Lage wäre, in einer politischen Debatte neue Narrative oder Konzepte anzubieten? Statt ihren Projekten eine positive Konnotation zu verleihen, wirken die Vertreterinnen und Vertreter ökologischer Politik oft regressiv oder gar panisch – und bar jeglichen Verständnisses dafür, dass die Menschen den Weckruf der Katastrophe nicht vernommen haben.
Das lässt sie auch moralisierend erscheinen. Aber Panik ist ermüdend und Notwendigkeit langweilig. Wählen heißt auch, überhaupt wählen zu wollen. Und wer möchte schon eine Partei wählen, für die man um das Überleben des Planeten willen oder aus moralischen Gründen abstimmen muss?

Menschen mit Bildern bewegen
Dass es der politischen Ökologie bislang nicht gelungen ist, politische Effekte zu bewirken, liegt daran – so meinen Bruno und ich –, dass sie den kulturellen Kampf weitgehend vernachlässigt hat. Stattdessen dachte sie – jetzt wird meine Freundin Luisa vielleicht wütend auf mich sein –, dass sie sich auf den Fakten zum kommenden Kollaps ausruhen und diese am besten in Moralin getränkt servieren könne – nicht du, Luisa! Aber wie uns das «Buch der Sprichwörter» lehrt: «Der Kluge sieht das Unheil und verbirgt sich.» Allemal besser, als auf Hölderlins «Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch» zu vertrauen.
Manche hätten auch den Hinweis der Künstlerin Jenny Holzer ernster nehmen sollen, dass mangelndes Charisma fatal sein kann – was sicherlich auch in der Politik gilt. Das Gegenmittel, wie schon angedeutet, bestünde darin, von Grund auf ein ganz neues kulturelles Universum zu schaffen: ein Register, das es ermöglicht, die politische Ökologie mit positiven Konnotationen zu durchdringen und sie mit Werten und Bildern anzureichern. Denn nur so können wir die politische Seele der Menschen berühren. Und nur dann kann die Ökologie Begeisterung hervorrufen, wird ein starkes «Wir» möglich, das seine Werte, seine Begriffe im Kampf gegen die alten Ideologien zur Anwendung bringen kann.
Ein Weckruf für Ökologie und Kultur
Zusammengefasst noch einmal die drei Punkte, an die wir die grünen Parteien erinnern wollen. Erstens: Will die Ökologie auf Augenhöhe mit den alten Ideologien konkurrieren, muss sie akzeptieren, dass es bei ihr auch um Konflikte geht – sie spaltet. Zweitens: Aus der Beschreibung dieser Konflikte muss ein starkes «Wir» entstehen. Und drittens: Der Kampf muss kulturell fundiert ein.
Dieser dritte Punkt macht deutlich, dass der Kunst und Kultur eine enorme Verantwortung zukommt. Denn wir benötigen ihre Fähigkeiten – und ihre Fragen, die nur sie stellen können. Denn schließlich geht es in ihrer Arbeit schon immer darum, Menschen etwas nahezubringen, was sie zuvor nicht berührt hatte. Daher mein letzter Appell heute, hier in Berlin – an die grünen Parteien und die Klimabewegung: Ihr müsst euch mit der Kunst, der Kultur verbünden, weil sie es versteht, Menschen zu erreichen! Und an die Kulturschaffenden: Kommt der Ökologie und ihren Bemühungen zu Hilfe, indem ihr das anbietet, was ihr schon immer angeboten habt: eine Neuverteilung von Ethik und Empfindungen! Denn wir befinden uns sicherlich auch in einer Krise der Empfindungen. Und auf welche Weise wir uns dieser Krise stellen – davon hängt wahrscheinlich der Erhalt der Lebensbedingungen auf unserem Planeten ab.
«Zur Entstehung einer ökologischen Klasse»
Das Buch, 2022 bei Suhrkamp erschienen, geht der Frage nach, wie es den grünen Parteien endlich gelingen kann, die offenkundigen ökologischen Krisen in politisches Kapital umzumünzen. Co-Autor Nikolaj Schultz, 1990 in Aarhus, Dänemark geboren, arbeitet als Soziologe an der Universität Kopenhagen, wo er zu den gesellschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels forscht.
Luisa Neubauer Die «fossile DNA» überwinden

Menschen mit Kultur zu erreichen, so Luisa Neubauer in ihrem anschließenden Vortrag, ist etwas, das der deutschen Klimabewegung durchaus schon in Ansätzen gelungen sei. In Erwiderung auf Nikolaj Schultz’ Vortrag reflektiert die Klimaaktivistin kurz die geknüpften Verbindungen, aber auch die Frontlinien zwischen Politik, Kultur und Klimakampf, um sich dann der hier wiedergegebenen Analyse der spezifisch deutschen Befindlichkeiten in der Klimakrise zu widmen.
Im Grunde sagen Nikolaj und Bruno, dass es im 20. Jahrhundert etwas gab, auf das sich alle quer durchs Parteienspektrum einigen konnten – die hohe Bedeutung der Produktivität. In Deutschland ließ sich das besonders deutlich beobachten: Egal, ob man auf der linken oder auf der konservativen Seite stand, alle stimmten zu, dass Produktivität etwas Gutes ist. Streit erwuchs erst aus der Frage, wer wie viel davon abbekommt. Es war also eine Verteilungsfrage, und zwar eine mit großem Konfliktpotenzial. Aber niemand hat damals bestritten, dass wir Produktivität brauchen – und die war in Deutschland schon immer an fossile Energien gebunden. Wenn wir jetzt also das Konzept der fossilen Produktivität infrage stellen, wenn wir jetzt sagen, wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass alles, was wir sind, was wir sein wollen und was wir je waren, im Kern von fossiler Produktivität geprägt ist, dann kommen wir an die DNA dessen, was Deutschland, was unsere Kultur ausmacht.
Fragen, die den Kern der Gesellschaft betreffen
Denken Sie nur an das Wirtschaftswunder und wodurch es ermöglicht worden ist. Es war die fossile Produktivität. Es war billige Kohleenergie und alles, was um sie herum entwickelt wurde. Es waren Gesetze, die geschaffen worden sind, um die Menschen zum Autofahren zu bewegen. Die Pendlerpauschale wurde – tatsächlich vor mehr als 100 Jahren – eingeführt, damit die Menschen Auto fahren. Warum wollte man das? Weil es die Autoindustrie angekurbelt hat. Es verschaffte uns Arbeitsplätze im Sektor der fossilen Brennstoffe. Es steigerte den Konsum der Menschen, es ließ eine ganze Industrie erwachsen.
Denken wir noch einen Schritt weiter: Wie lautet die deutsche Erzählung darüber, wie wir den Nationalsozialismus überwunden haben? Es war harte Arbeit, eine florierende Wirtschaft – und fossile Produktivität, die uns von all dem Schlimmen, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Deutschland ausging, weggebracht haben und uns in eine neue Ära katapultierten, in der Deutschland wieder «glänzen» konnte. Wenn wir also die fossile Produktivität in Deutschland infrage stellen, und damit die Kohle-, Gas- und Autoindustrie, dann stellen wir genau das infrage, was Deutschland ausmacht – und viele andere Länder um uns herum auch. Wir stellen infrage, was wir sind und was wir sein wollen, womit wir uns identifizieren, was wir sein können und was wir sein sollten. Es ist eine weit umfassendere Frage, die mit Zahlen und Fakten allein nicht beantwortbar ist: eine Frage, die unsere gesellschaftliche DNA betrifft.
Wir konnten sehen, wie klar dieser Zusammenhang während der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Energiekrise zum Tragen kam. Das Gas war plötzlich ein echtes Problem, weil es aus einem autokratischen Staat bezogen wurde. Erinnern Sie sich an den Kriegsbeginn: Alles ergab plötzlich Sinn. Wir erkannten, dass es beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nicht nur um die Umwelt geht, sondern auch um den Frieden. Es geht um Autokraten und um Mörder. Erneuerbare Energien sind nicht nur billig und umweltfreundlich, sie können uns auch unabhängig von Autokraten machen.
Erinnern Sie sich, wie Christian Lindner im Bundestag stand und sagte, bei den Erneuerbaren handele es sich um «Freiheitsenergien»? Ich meine, wie weit ist es mit diesem Typ eigentlich gekommen? Ein bisschen zu spät zur Party vielleicht, aber hey – er war da! Und was kam dann, ein paar Monate oder sogar schon ein paar Wochen danach? Es war völlig klar, dass wir uns von fossilen Energieträgern verabschieden müssen. Aber was passierte in Deutschland und auf der ganzen Welt stattdessen? Das größte Comeback fossiler Brennstoffe, das wir seit Langem erlebt haben.
Nicht, weil es der billigste Weg ist – fossile Brennstoffe sind lächerlich teuer. Nicht, weil man die Idee nicht mochte, von Autokraten unabhängig zu sein. Nein, es ist die fossile Produktivität in uns, die darüber entscheidet, wie weit ein Land kommen kann. Wir können das ändern. Aber selbst wenn die Lösungen auf dem Tisch liegen, selbst wenn Erneuerbare viel mehr Sinn ergeben, werden viele bei fossilen Brennstoffen bleiben. Es sei denn, wir fordern diese Machtdynamik und die Kultur der fossilen Brennstoffe heraus. Wir müssen uns fragen, wie wir eine machtvolle Gegenkultur schaffen, die noch stärker ist als jedes Argument, das wir jemals vorbringen könnten.
Ein Kulturkrieg um Klimafragen
Wenn wir uns mit Kultur befassen, gibt es eine Sache, die vielen Menschen Sorgen bereitet: In Deutschland bricht ein Kulturkrieg um Klimafragen aus. Nikolaj und ich haben uns darüber unterhalten, dass auf jedem Parkplatz und auf jedem Radweg plötzlich Kampfgeschrei ertönt. Die Aufregung ist groß. Ich höre viele Umweltschützer und Klimaaktivisten sagen: «Ach herrje, die Rechtspopulisten und die FDP-Typen haben einen Kulturkampf losgetreten, und jetzt verlieren wir den Klimadiskurs.» Ich frage mich mittlerweile, warum wir jemals dachten, wenn wir übers Klima sprechen, ginge es nicht um Kultur. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber an einem Punkt hat die FDP und auch die CDU recht: Es ist eine Kulturfrage.
Wir befinden uns in einem Kulturkampf, um sehr weitreichende Fragen zu klären: Was ist ein gutes Leben? Was ist ein freies Leben? Was ist ein gerechtes Leben? Was ist ein sicheres Leben? Und wenn es nicht die fossile Version des Status quo ist, wie kann eine bessere Zukunft aussehen? Sobald wir die fossile Kultur leugnen, weil wir meinen, es gehe nicht um ideologische Fragen, sondern um Fakten und Zahlen, um schiere Logik – solange wir leugnen, dass ein Kulturkampf entbrannt ist, werden wir ihn verlieren, weil wir nicht genug gerüstet sein werden. Dann werden wir nie eine angemessene Antwort auf den Status quo der fossilen Brennstoffe und das ganze Greenwashing haben. Erst in dem Moment, in dem wir zu der Erkenntnis kommen, dass es eine Frage der Kultur ist, können wir uns emanzipieren.
Freiräume schaffen, um Siege zu erringen
Wir können uns tatsächlich selbst ermächtigen und die Konfliktlinien frei wählen, an denen wir kämpfen wollen. Und wir können Angebote machen, die ziehen. Eine Sache, die heute an diesem 2. September in Berlin passiert ist, hat in dieser Hinsicht große Symbolkraft. Ich spreche vom Protest gegen die Berliner Stadtautobahn A100. 20.000 Menschen tanzten dort auf einem Rave gegen deren Ausbau. Das war unglaublich kraftvoll, nicht nur wegen der 20.000 Menschen, sondern auch, weil dort ein konkretes Angebot erlebbar wurde. Ich war auch da. Sofort, als ich ankam, wurde mir klar, dass uns genau so etwas vorwärtsbringt. Denn es vereint alles, was die zynischen Fossilverfechter hassen: Es ist kostenlos. Es ist gerecht. Es ist wunderschön. Es macht glücklich. Es ist da draußen, es ist laut und es strotzt vor Selbstbewusstsein.
Noch einmal: Wir hätten Unmengen von Argumenten liefern können, warum die A100 keine gute Idee ist, Clubkultur aber schon. Aber was heute dort passiert ist, ist besser: Es war einfach unübersehbar, dass dort ein Freiraum entstand mit allem, was wir wissen müssen, um zu kämpfen – und um zu gewinnen. Bei diesem Protest ging es nicht mehr darum, recht zu haben, sondern darum, einen Sieg zu erringen – mit etwas Begehrenswertem, das voller Ästhetik ist. Vielleicht sind wir hier also gar nicht mehr allzu weit von Brunos und Nikolajs Gedanken entfernt.
Übersetzung: Jari Gärtner / Einleitungstexte: Georg Dietsche
Luisa Neubauer, 1996 in Hamburg geboren, ist Klimaaktivistin und Mitorganisatorin von «Fridays for Future». Sie gilt als eine der prominentesten Stimmen der deutschen Klimabewegung. Im Jahr 2021 gewann sie gemeinsam mit anderen das bahnbrechende Verfassungsgerichtsurteil «Neubauer et al. vs. Deutschland» gegen die deutsche Regierung im Kampf für politische Klimaschutzmaßnahmen. Sie hat sich mit mehreren Staatsoberhäuptern getroffen und drei Bestseller zur Klimakrise veröffentlicht.
Videos der Vorträge
-

Luisa Neubauer und Nikolaj Schultz im Diskurs
Wie könnte eine politisch-ökologische Kultur im Sinne der Klimabewegung aussehen? Die Diskussion bei der «Langen Nacht des Klimas» 2023.
-

Nikolaj Schultz: «Three Points for the Political Ecologists to Remember»
Vortrag in englischer Sprache bei der «Langen Nacht des Klimas» 2023.
-

Luisa Neubauer: «Polical culture and climate movement»
Vortrag in englischer Sprache bei der «Langen Nacht des Klimas» 2023.